Wohlbefinden in der digitalen Welt
Die Forschungsgruppe widmet sich der Untersuchung der Auswirkungen der Nutzung digitaler Technologien auf die Wahrnehmung, Kognition, Emotionen sowie das Verhalten der Nutzer:Innen. Ziel ist es, die Mechanismen zu identifizieren, die das individuelle Wohlbefinden verändern und die Wahrnehmung sozialer Prozesse beeinflussen.
Digitale Technologien haben alle Bereiche des menschlichen Lebens durchdrungen. Neben spürbaren Auswirkungen im privaten Bereich, haben sowohl Arbeits- als auch gesellschaftliche Prozesse einen dramatischen Wandel erlebt. Nicht zuletzt hat die COVID-19 Pandemie diese Veränderungen maßgeblich beschleunigt. Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Nutzung digitaler Technologien auf die Wahrnehmung, Kognition, Emotionen sowie das Verhalten der Nutzer:Innen sind ambivalent, so dass weiterhin viele offene Fragen in Bezug zu den speziellen psychologischen Folgen, sowie den Mechanismen hinter den Auswirkungen bestehen. Nicht zuletzt existieren neue Ansätze von Erhebungs- und Auswertungsmethoden, die eine reliablere und validere Messung von tatsächlichem Nutzungsverhalten ermöglichen. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich diese Forschungsgruppe auf die Rolle digitaler Technologien auf die Wahrnehmung, das Verhalten und das Wohlbefinden der Nutzer:Innen auf individueller, organisatorischer und gesellschaftlicher Ebene.
Digitale Technologien und Wohlbefinden im privaten Bereich
Forschung hat aufgezeigt, dass Kontextfaktoren wie Nutzungsmuster, die Netzwerkstruktur, die Charakteristika sozialer Informationen, Plattform- und Nutzereigenschaften sowie algorithmische Optimierungen eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie sich die Nutzung digitaler Technologien auf Nutzer:Innen auswirkt. Ein übergeordnetes Ziel der Forschungsgruppe besteht darin, ein tieferes Verständnis über diese Kontextfaktoren zu erhalten. Weiterhin steht die Entwicklung von Interventionen im Fokus, die einen positiven Einfluss auf Individuen haben sowie die objektive Erfassung der tatsächlichen Mediennutzung.
Die folgenden Forschungsfragen sind für dieses Teilprojekt zentral:
- Welchen Einfluss hat die (tatsächliche) Nutzung digitaler Technologien auf verschiedene Aspekte des psychologischen Wohlbefindens, die Wahrnehmung und das Verhalten von Individuen?
- Was sind die Mechanismen bzw. Kontextfaktoren hinter diesen Auswirkungen?
- Was kann getan werden, um den nachteiligen Entwicklungen entgegenzuwirken?
Digitale Technologien und gesellschaftliche Auswirkungen
Entwicklungen auf der Mikroebene können zu kollektiv größeren Herausforderungen führen, welche die Gesellschaft als Ganzes betreffen. Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass digitale Technologien bestimmte psychologische Prozesse auslösen und dadurch die Wahrnehmung der Gesellschaft und Verhaltensweisen beeinflussen können. Allerdings bleibt die Forschung, die eine Verbindung zwischen Technologienutzung und den psychologischen Prozessen als primärem Auslöser von (un)erwünschten gesellschaftlichen Entwicklungen herstellt, nach wie vor lückenhaft. In diesem Teilprojekt wird untersucht, wie digitale Technologien (un)erwünschte Denkmuster, Emotionen, und Verhaltensweisen hervorrufen, welche das Individuum beeinflussen und darüber hinaus auch Konsequenzen für die Gesellschaft und die Wirtschaft haben können.
Die folgenden Forschungsfragen sind für dieses Teilprojekt zentral:
- Welche Rolle spielen digitale Technologien bei gesellschaftsrelevanten Wahrnehmungen, Einstellungen und Entscheidungen?
- Inwieweit können spezifische psychologische Prozesse, die durch die Technologienutzung hervorgerufen werden, zu sozial (un)erwünschten Entwicklungen beitragen?
- Und welche Möglichkeiten gibt es, unerwünschte Entwicklungen abzumildern und vorzubeugen?
Digitale Technologien und Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Die Nutzung digitaler Kommunikationstechnologien am Arbeitsplatz hat im Zuge der COVID-19-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Trotz vieler Vorteile wird die zunehmende Digitalisierung am Arbeitsplatz auch mit Überlastung, Stress, Rollenkonflikten, weniger sozialen Interaktionen und sogar psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. In Anbetracht der Tatsache, dass zahlreiche Unternehmen an Heimarbeitsmodellen festhalten wollen, werden diese Tools auch weiterhin eine große Rolle in den Arbeitspraktiken und im täglichen Leben der Mitarbeiter spielen. Gleichzeitig ist das vorhandene Wissen über die Rolle dieser Kommunikationstechnologien im Arbeitskontext stark fragmentiert und mit den Messproblemen der Mediennutzung belastet.
Die folgenden Forschungsfragen sind für dieses Teilprojekt zentral:
- Welchen Einfluss hat die zunehmende Nutzung digitaler Kommunikationsmittel auf individueller und organisatorischer Ebene?
- Was sind die Mechanismen bzw. Kontextfaktoren hinter diesen Ergebnissen?
- Und was kann getan werden, um möglichen negativen Konsequenzen entgegenzutreten?
Mitglieder der Forschungsgruppe
-

Prof. Dr. Hanna Krasnova
Direktorin, Principal Investigator
-

Dr. Annika Baumann
Forschungsgruppenleiterin
-

Dr. Antonia Meythaler (geb. Köster, in Elternzeit)
Forschungsgruppenleiterin
-

Eva-Marie Geier
Forschungsgruppenkoordinatorin
-

Melanie Jacobsen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
-

Jakob Jedrysek
Studentischer Mitarbeiter
-
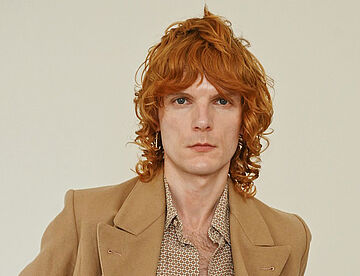
Dr. Hannes-Vincent Krause
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
-

Hannah Timna Logemann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
-

Heike Lohmar
Forschungsgruppenassistenz

