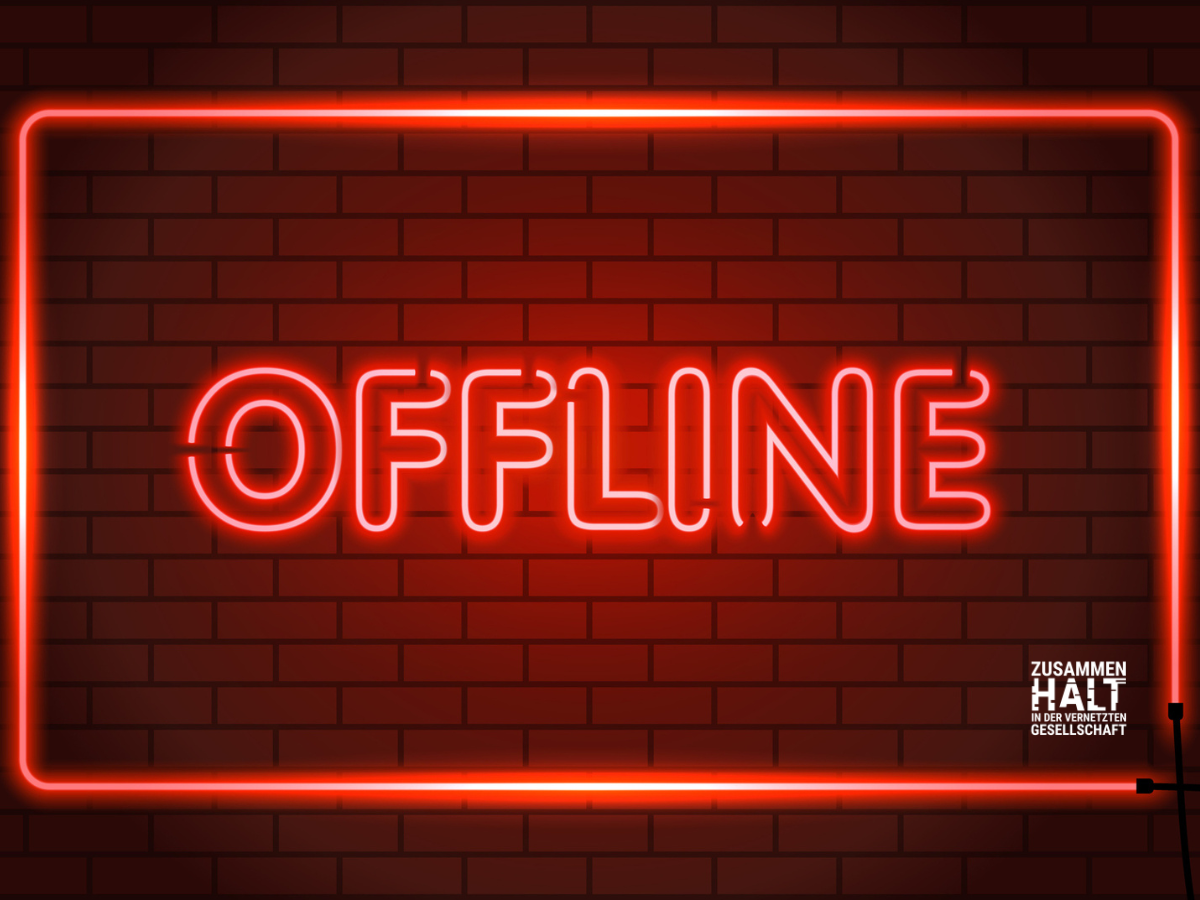
„Soziale Ungleichheit schlägt sich auch im Internet nieder“
02/18/2025Die Diskussionen und Analysen über den Einfluss von digitalen Plattformen auf unsere Demokratie brechen nicht ab. Doch was bedeutet es eigentlich für unsere Gesellschaft, dass viele Menschen gar nicht online sind? Wir sprachen mit Weizenbaum-Forscherin Merja Mahrt, Expertin für Mediennutzung.
Die Ängste und Unsicherheiten über die Auswirkung von Sozialen Medien sind aus aktuellen Debatten über den Zustand unserer demokratischen Institutionen nicht mehr wegzudenken. Die Warnungen vor Desinformationenkampagnen, Tipps zum Umgang mit Hass im Netz und Kritik an algorithmischen Filtern sind Teil unseres digitalen Alltags geworden. Doch sind wir davon alle gleichermaßen betroffen? Was bedeutet es eigentlich für demokratische Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass viele Menschen gar nicht online sind? Wir sprachen mit Weizenbaum-Forscherin Merja Mahrt über diejenigen, die vom Internet ausgeschlossen sind, woran das liegt und was das mit Politik zu tun hat.
Aktuell blicken viele Menschen mit Sorge auf die Entwicklungen bei den großen Social-Media-Plattformen und den Einfluss des Internets auf die öffentliche Meinung. Geht diese Debatte an denen vorbei, die gar nicht online sind?
Es gibt verschiedene Formen der Nicht-Nutzung. In der Forschung unterscheiden wir zwischen absoluten Offliner:innen und Menschen, die nur selten online sind. Wer wirklich offline ist, wird von digitaler Hetze und Fake News kaum erreicht, interessiert sich aber oft auch sowieso weniger für Politik.
Auch unter den Online-Nutzer:innen gibt es viele, die kaum mit Politik oder Nachrichten in Berührung kommen. Diese können anfälliger für Fake News oder Desinformation sein, da sie schlechter einschätzen können, welche Quellen vertrauenswürdig sind und wann es sinnvoll wäre, Informationen weiter zu recherchieren.
Unterschiedliche Nutzungsweisen sind also relevant, wenn wir über die öffentliche Meinung sprechen. Die „Öffentlichkeit“ ist ja mehr als das Digitale. Und umgekehrt gibt es online viele Bereiche, die mit Politik und Nachrichten nichts zu tun haben. Und schließlich finden sich viele online diskutierte Themen auch in klassischen Medien wieder, man kann online- und offline-Einflüsse also nicht immer so einfach auseinander halten.
Wie viele Menschen sind offline, und warum?
Rund 6 % der Deutschen über 14 Jahren sind komplett offline. Dabei handelt es sich mehrheitlich um ältere Menschen, besonders Frauen, mit niedrigerem Einkommen und Bildungsniveau sowie Nicht-Erwerbstätige. Auch im ländlichen Raum gibt es mehr Offliner:innen. Über die Mediennutzung von obdachlosen und Menschen mit schweren Behinderungen wissen wir nur sehr wenig, also auch, wie viele von ihnen das Internet im Alltag nutzen.
In der Zeit, als das Internet sich verbreitete, waren Schule, Ausbildung und Beruf die zentralen Orte des Erstkontakts. Wer diese Berührungspunkte nicht hatte, blieb häufig außen vor, und einige ältere Menschen sind es bis heute geblieben.
Neben den absoluten Offliner:innen sind viele Menschen nur wenig online. Im letzten Jahr waren etwa 60 % der Deutschen ab 14 Jahren auf sozialen Medien aktiv – zwei von fünf also nicht. Messenger-Dienste wie WhatsApp dagegen werden von mehr Menschen, nämlich 82 %, genutzt, da sie besonders niedrigschwellig sind und viele sie sehr nützlich im Alltag finden.
Welchen Stellenwert digitale Medien im Alltag spielen, hängt dann stark mit sozialen und wirtschaftlichen Faktoren zusammen. Armut beeinflusst die Art der Mediennutzung – sei es durch fehlende finanzielle Mittel für Geräte oder einen Handyvertrag mit viel Nutzungszeit. Diese Muster sehen wir auch in anderen Ländern. Soziale Ungleichheit schlägt sich auch heute noch im Internet nieder.
Warum interessieren sich manche Menschen nicht für Politik – und warum sind viele davon auch offline?
Was für Offliner:innen typisch ist, gilt oft auch für politisch Desinteressierte: begrenzte Ressourcen, vor allem durch wenig Zeit oder eine prekäre wirtschaftliche Lage. Das bedeutet nicht, dass alle Offliner:innen unpolitisch sind, aber die Muster sind auffällig ähnlich. Manche Menschen vermeiden politische Themen ganz bewusst, andere interessieren sich schlicht nicht dafür oder kommen nicht dazu.
Da spiegelt sich auch ein altes sexistisches Muster wieder, das zum Beispiel in der Debatte über Frauenquoten in der Politik auftaucht. So gibt es nach wie vor die Vorstellung, Politik sei nichts für Frauen, was dazu führt, dass sie sich immer noch im Schnitt weniger damit auseinandersetzen.
Viele Menschen, die in ihrem Leben mit anderen Themen und Problemen beschäftigt sind, haben daneben keine Energie und Zeit, um sich mit Politik zu beschäftigen. Einige ältere Menschen, die bereits mehrere Regierungen erlebt haben, haben das Gefühl, dass politische Wechsel keine spürbaren Veränderungen für ihr Leben bringen. Darum lohnt es sich aus ihrer Sicht auch nicht, sich in Politik einzubringen.
Was bedeutet es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass die digitale Öffentlichkeit und auch die politische Sphäre so unrepräsentativ sind?
Für eine funktionierende Gesellschaft ist es essenziell, dass alle Gruppen am öffentlichen Diskurs teilhaben können und ihre Anliegen gehört werden. Offline zu sein ist nicht per se problematisch – man kann auch über andere Medien an Öffentlichkeit teilhaben. Problematisch ist jedoch, dass es sich sowohl bei den Offliner:innen als auch bei den politisch Uninteressierten oft um die gleichen gesellschaftlich benachteiligte Gruppen handelt: Menschen mit niedriger Bildung und Einkommen, ältere Menschen und Frauen. Diese Gruppen sind in vielen gesellschaftlichen Bereichen unterrepräsentiert – und das setzt sich auch online fort. Dadurch können bestehende Ungleichheiten verstärkt werden.
Gesellschaftliche Teilhabe wird für Offliner:innen zunehmend schwieriger, wenn immer mehr Dienstleistungen und Informationen ausschließlich digital angeboten werden. In Großstädten wie Berlin gibt es zu Smartphone-Apps noch analoge Alternativen wie Aushangfahrpläne oder Stadtpläne an Haltestellen. Doch in anderen Regionen oder in Zukunft kann das anders aussehen.
Besonders absurd sind Angebote, z.B. für soziale Dienstleistungen, die speziell für ältere Menschen gedacht sind, aber nur online verfügbar sind. Das geht dann genau an denjenigen vorbei, die sich vielleicht sowieso schon vom digitalen Wandel ausgeschlossen fühlen.
Es gibt ja aktuell bei Jüngeren einen gegenläufigen Trend, Stichwort „Präsenz ist Premium“, digital detox oder auch die Rückkehr des Tastenhandys. Wie bewertest Du das?
Es gibt in der Forschung nichts, was auf einen Massenrückzug aus dem Internet hindeutet. Was sich allerdings seit Jahren zeigt, ist, dass viele Nutzer:innen – auch sehr junge – ihre Online-Zeit reduzieren oder bestimmte Apps deinstallieren, später aber oft wieder zurückkehren.
In den Studien zeichnet sich auch ab, dass digitale Mediennutzung nicht auf alle gleichermaßen wirkt. Selbst wenn zwei Menschen dieselbe Plattform mit ähnlicher Nutzungsweise verwenden, kann das für den einen positive und für den anderen negative Effekte zum Beispiel auf das Wohlbefinden haben. Eine allgemeingültige Empfehlung gibt es daher nicht – jede:r muss selbst herausfinden, was am besten zum eigenen Alltag passt.
Bei all dem, was wir über Spaltung, Hass und Radikalisierung im Netz hören: Sollten überhaupt mehr Menschen online sein?
Die UN betrachten den Zugang zu modernen Informations- und Kommunikationstechnologien als Teil der Menschenrechte. Das heißt, die Möglichkeit sollte bestehen. Muss man jetzt online sein? Sicherlich nicht, aber es bringt in vielen Lebensbereichen Vorteile: Es gibt zum Beispiel Studien über die positiven Auswirkungen auf Gesundheitswissen oder berufliche Möglichkeiten für Onliner:innen im Vergleich zu Offliner:innen.
Ebenso sind Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen und sich mit Menschen in ähnlicher Lage zu vernetzen, mit dem Internet viel größer geworden. Dieses demokratisierende Potenzial des Internets wurde schon früh gesehen. Das ist zuerst für Self-Help-Foren erforscht worden, in denen sich zum Beispiel Betroffene von Krankheit oder Behinderung austauschen und gegenseitig unterstützen konnten. Das gilt auch für andere marginalisierte Communities, die sich online sichtbar machen und Aufmerksamkeit für ihre Anliegen gewinnen können – und nicht darauf warten müssen, dass über sie gesprochen wird.
Wie können wir mehr Menschen besser ins Internet einbinden?
Die Wahrscheinlichkeit, dass heutige Offliner:innen noch ins Internet gehen, ist gering. Entsprechende Programme wurden bereits in den 2010er-Jahren eingestellt. Der Fokus liegt nun darauf, Digitalkompetenzen bei Angehörigen und Betreuungspersonen zu stärken, um indirekte Unterstützung zu ermöglichen.
Letztlich geht es um allgemeine Fragen von gesellschaftlicher Teilhabe, die über Mediennutzung weit hinausgeht . Es ist wichtig, benachteiligte Menschen in ihrem Alltag zu entlasten – in der Hoffnung, dass sie sich dann auch stärker in die Gesellschaft einbringen können. Wir können niemandem sagen, der oder die gar nicht weiß, wie sie den Alltag überhaupt bewältigen sollen, sie müssten sich auch noch mit Politik beschäftigen oder digitale Kompetenzen erlernen.
Man kann aber Infrastrukturen aufbauen, also z.B. eine bessere digitale Ausstattung von Schulen in ärmeren Stadtteilen. So könnte sichergestellt werden, dass jedes Kind die Möglichkeit erhält, digitale Kompetenzen zu erwerben und es nicht daran scheitert, dass Zuhause kein Geld für einen Internetzugang oder ein Gerät übrig ist.
Merja Mahrt ist Kommunikationswissenschaftlerin und habilitierte sich 2017 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit einer Arbeit zu digitaler Fragmentierung, Echokammern und Filterblasen. Sie wurde 2010 an der Universität von Amsterdam promoviert, nachdem sie an der Freien Universität Berlin und der Université Michel de Montaigne – Bordeaux III studiert hatte. Ihre Forschung konzentriert sich auf die sozialen Kontexte und Auswirkungen der Nutzung digitaler Medien. Für ihr aktuelles Buchprojekt schreibt sie über digitale Öffentlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Das Interview führte Leonie Dorn
Dieses Interview ist Teil des Fokus „Zusammenhalt in der Vernetzen Gesellschaft.“ Wissenschaftler:innen des Weizenbaum-Institutes geben in Interviews, Berichten und Dossiers Einblicke in ihre Forschung zu den verschiedensten Aspekten von digitaler Demokratie und digitaler Teilhabe. Mehr erfahren