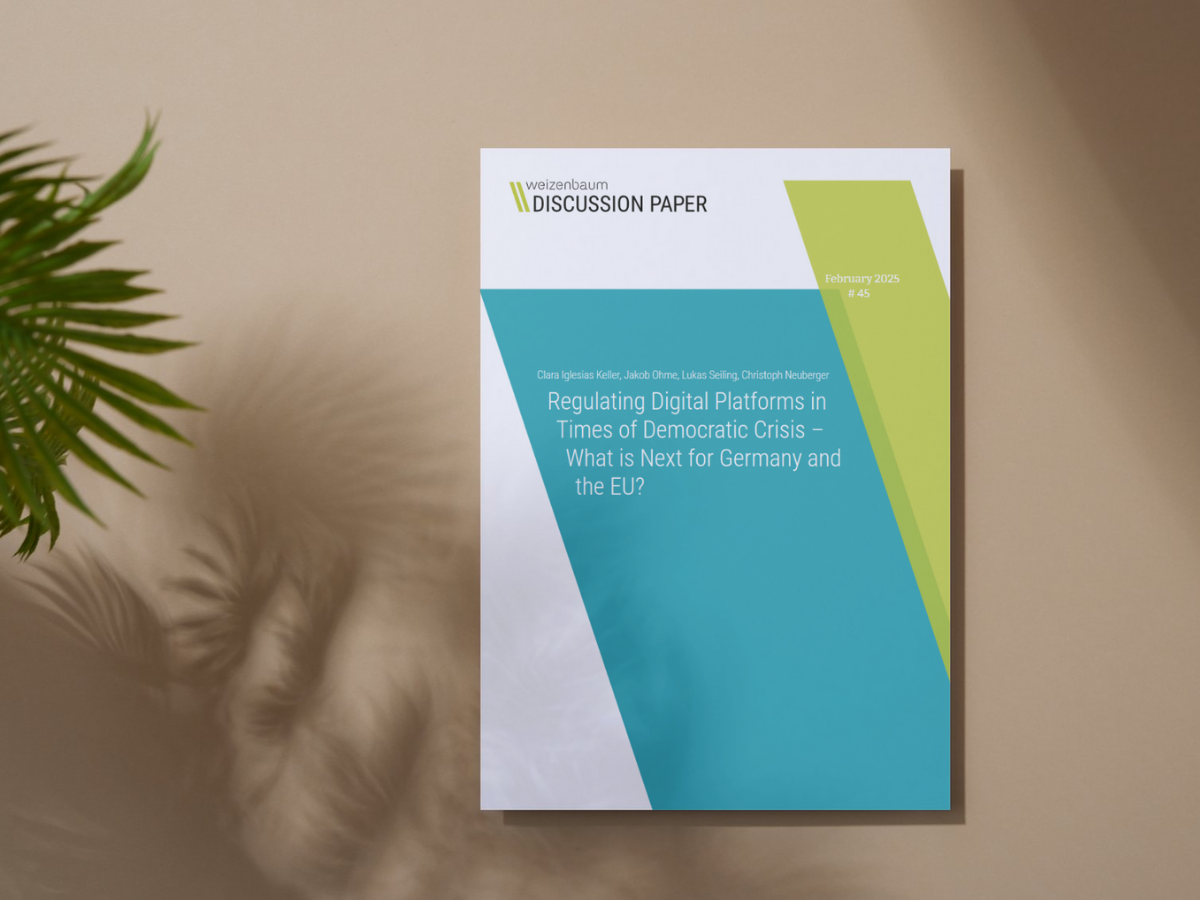
Die Macht digitaler Plattformen in Krisenzeiten der Demokratie – neues Discussion Paper
10.02.2025In einem neuen Diskussionspapier untersuchen Weizenbaum-Forschende die jüngsten Veränderungen bei der Inhaltemoderation großer Social-Media-Plattformen und analysieren sie mit Blick auf die krisenhafte Entwicklung der liberalen Demokratie.
Digitale Plattformen sind zu wichtigen Infrastrukturen sozialer Interaktion geworden, die aus unserer Gesellschaft kaum noch wegzudenken sind. Die Kehrtwende bei der Content-Moderation und die Abschaffung von Faktenchecks durch große Anbieter wie X oder Meta ist vor diesem Hintergrund Anlaß zu großer Sorge. Die Weizenbaum-Forschenden Clara Iglesias Keller, Jakob Ohme, Lukas Seiling und Christoph Neuberger haben diese Entwicklung mit Blick auf die Erosion der liberalen Demokratie untersucht, insbesondere in den USA. Wir haben Clara Iglesias Keller, Leiterin der Forschungsgruppe “Technik, Macht, Herrschaft”, zu diesen Entwicklungen befragt – und welche Schlüsse sich daraus für Deutschland und die Europäische Union ziehen lassen.
Große Social-Media-Plattformen wie Meta und X haben gerade ihre Moderations-Richtlinien stark verändert. Wie bewerten Sie die aktuellen Entwicklungen? Was bedeutet das für die öffentliche Meinungsbildung in der Demokratie?
Die Ankündigungen von Mark Zuckerberg deuten auf eine ideologische Neuausrichtung hin. Meta will in den USA die Partnerschaften mit Faktenprüfern beenden und Moderations-Standards lockern. Es soll weniger Einschränkungen bei Themen wie Migration und Geschlechterfragen geben, auch Diversity-Programme sollen beendet werden.
Damit folgt Zuckerberg dem Weg, den bereits Elon Musk mit X (ehemals Twitter) eingeschlagen hat. Dort wurden ja auch Accounts rechtsextremer Akteur:innen reaktiviert. Diese Maßnahmen werden rechtsextreme Inhalte sichtbarer machen, auch Hassrede und Desinformation werden weitere Verbreitung finden. Dies alles kann die öffentliche Debatte in gefährlicher Weise beeinflussen.
Sie sprechen von „systemischer Macht über die öffentliche Meinung“. Wie genau üben Plattformen wie Meta und X diese Macht aus, und warum ist das für die Demokratie so problematisch?
Anders als klassische Medien, die redaktionelle Entscheidungen treffen, beeinflussen Plattformen die Sichtbarkeit von Informationen und Aufmerksamkeit automatisiert, z.B. durch algorithmische Kuratierung und Filter. Dabei verfolgten sie in erster Linie kommerzielle, aber zunehmend auch politische Interessen. Indem digitale Plattformen darüber entscheiden, welche Themen und Meinungen verstärkt oder unterdrückt werden, welche Inhalte sichtbar werden und welche nicht, beeinflussen sie die öffentliche Debatte. Dadurch haben sie eine „systemische Macht“, die sich von der öffentlichen Macht traditioneller Medien deutlich unterscheidet.
Welche Risiken sehen Sie in der Zusammenarbeit zwischen Plattformen und Regierungen? Sehen Sie bereits konkrete Beispiele, wie dies in Deutschland oder Europa geschieht?
Die enge Zusammenarbeit zwischen Plattformen wie Meta und der Trump-Regierung birgt immense Risiken für demokratische Prozesse. Sie verwischt die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Kommunikationsinfrastrukturen, was nun dafür genutzt werden kann, einseitig Anhänger zu mobilisieren und öffentliche Debatten in eine bestimmte Richtung zu lenken.
In Europa sehen wir bereits Beispiele dafür, wie Plattformen in die Politik eingreifen. Dies war etwa der Fall, als Elon Musk über X zur Wahl der AfD aufrief. Oder gewählte Politiker:innen angegriffen und verunglimpft werden. Angesichts der Meinungsmacht, die Plattformen haben, ist es für die politische Debatte schädlich, wenn über ihre Infrastrukturen radikale politische Meinungen verbreitet werden. Dies gilt insbesondere in Wahlkampfzeiten, in denen diese Plattformen ein wichtiger Kommunikationskanal der Politiker:innen sind.
Wie können Demokratien mit solchen direkten Eingriffen in die politische Meinungsbildung umgehen?
Nun zunächst ist es wichtig, dass es eine tiefe Krise der Demokratie gibt, die sich an vielen unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Formen zeigt und sicherlich über die Frage digitaler Medien und Plattformen hinausgeht. Aber richtig ist eben auch, dass Demokratien sicherstellen müssen, dass diese Plattformen nicht einseitig für politische Einflussnahme missbraucht werden können. Um Meinungsvielfalt zu sichern und die Konzentration von Meinungsmacht zu verhindern, wäre eine Möglichkeit, die bestehenden Gesetze, wie den Medienstaatsvertrag in Deutschland, in diesem Punkt auf digitale Plattformen auszuweiten.
Bisher wurden die Lockerungen von Meta nur für die USA angekündigt. Was kommt auf Europäer:innen zu, geraten unsere Plattformregulierungen wie der Digital Services Act (DSA) nun unter Druck?
Der Digital Services Act ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er zielt darauf ab, Transparenz und Fairness zu fördern sowie illegale und schädliche Aktivitäten einzudämmen. Allerdings hängt seine Wirksamkeit stark von der praktischen Umsetzung und Durchsetzung ab. Viele Bestimmungen lassen den Plattformen Interpretationsspielräume, die es ihnen erlauben, ihre Machtpositionen aufrechtzuerhalten.
Nach Zuckerbergs Ankündigung stellte Meta klar, dass es seine Richtlinien zur Inhaltsmoderation in Europa nicht ändern werde. In der ursprünglichen Erklärung wurde jedoch ausdrücklich die Absicht hervorgehoben, gemeinsam mit Präsident Trump gegen Regierungen auf der ganzen Welt vorzugehen, die amerikanische Unternehmen einschränken. Das gefährdet die Durchsetzung des DSA, insbesondere wenn die Plattformen möglicherweise nicht mehr kooperieren.
Der DSA sieht Mechanismen wie „Trusted Flaggers” und Transparenzberichte vor. Wie realistisch ist es, dass diese Instrumente in der Praxis effektiv umgesetzt werden können?
Die Idee der „Trusted Flaggers” und der Transparenzberichte ist vielversprechend, aber ihre Effektivität hängt von der konsequenten Umsetzung und Überwachung ab. Die Plattformen behalten nach wie vor die Entscheidungsgewalt darüber, welche Inhalte entfernt werden und wie sie Risiken definieren. Diese Interpretationsspielräume könnten die Wirkung der Maßnahmen erheblich einschränken. Aber um solche Risiken evidenzbasiert einschätzen zu können, ist übrigens auch eine Gewährleistung des Datenzugangs für Forschende ist von großer Bedeutung.
Es gibt Diskussionen darüber, ob Plattformen stärker reguliert oder sogar in Einzelfällen verboten werden sollten. Wie realistisch ist ein solches Verbot?
Ein Verbot von Plattformen ist eine sehr schwierige Maßnahme, vor allem angesichts der breiten Akzeptanz und Nutzung solcher Dienste in der Bevölkerung. Der Fall des TikTok-Verbots in den USA zeigt, wie herausfordernd, aber auch umstritten ein solches Vorgehen sein kann. Dies würde ein hohes Maß an öffentlicher Unterstützung und nachvollziehbarer juristischer Rechtfertigung erfordern.
Neben Regulierungen gibt es auch die Idee, gemeinwohlorientierte Plattformen zu schaffen. Wie könnte eine solche Alternative aussehen?
Ja, das ist eine wichtige Debatte, die wir wirklich dringend führen sollten. Gemeinwohlorientierte Plattformen könnten auf Werten wie Freiheit, Gleichheit und Vielfalt aufbauen, ähnlich wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Sie müssten unabhängig finanziert und betrieben werden, um sicherzustellen, dass sie den demokratischen Diskurs fördern und nicht von kommerziellen oder politischen Interessen beeinflusst werden.
Was muss in den nächsten Jahren passieren, damit das digitale Umfeld die demokratischen Werte schützt, anstatt sie zu gefährden?
Es ist entscheidend, dass die Umsetzung und Durchsetzung von Regulierungen wie dem DSA priorisiert wird. Gleichzeitig muss die Diskussion über neue Modelle einer demokratischen digitalen Öffentlichkeit vorangetrieben werden. Plattformen, die sich am Gemeinwohl orientieren, könnten hier eine Schlüsselrolle spielen. Dabei müssen die Werte der liberalen Demokratie – also Freiheit, Gleichheit und Vielfalt – eine unverhandelbare Grundlagen bleiben.