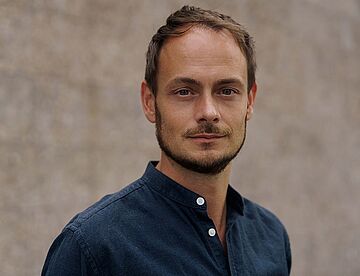Auswirkungen der digitalen Segregation
Nachrichtenrepertoires, Verschwörungsglaube, demokratische Einstellungen und politisches Engagement des Publikums alternativer Medien.
Hintergrund
In diesem Projekt wurde eine Metaanalyse der Entwicklungen der Forschung zu Verschwörungstheorien und ihrer Rolle im öffentlichen Diskurs (insbesondere in den Social Media) geleistet. Bisherige Forschung deutet darauf hin, dass verschiedene Verschwörungsdiskurse sowie auch die politischen Akteure und Medien, die solche Narrative verbreiten, stark miteinander vernetzt sind. Social-Media-Plattformen (z. B. Facebook und YouTube) und Messenger (z. B. Telegram) werden intensiv zur Verbreitung dieser Narrative genutzt.
Entgegen weit verbreiteter Befürchtungen haben diese Entwicklungen jedoch zumindest in Deutschland nicht zu einem Riss in der Mitte der Gesellschaft geführt, sondern zu einer (Selbst-)Segregation kleiner, radikalisierter Gruppen an deren Rändern. Diese Gruppen sind besonders anfällig für ausländische Einflüsse und die Hauptziele der russischen Propaganda, die seit langem Verschwörungstheorien als wichtigstes Instrument zur Verbreitung ihres Einflusses im Ausland einsetzt. In dem geplanten Projekt wurde eine Metaanalyse der Forschung zu diesem Thema geleistet werden. Daraus wurde eine Online-Befragung entwickelt, die die radikalisierten Gruppen genauer unter die Lupe nimmt, um die Zusammenhänge zwischen ihrem Nachrichtenrepertoire (insbesondere auf digitalen Plattformen), ihrem Verschwörungsglauben, ihrer Anfälligkeit für Propaganda, ihren demokratischen Einstellungen und ihrem politischen Engagement besser zu verstehen.
Ziele
Die Forschungsziele waren:
- die Identifizierung des Publikums alternativer Medien anhand ihres Nachrichtenrepertoires,
- die Untersuchung, inwieweit sich dieses Nachrichtenrepertoire von dem der Nutzer herkömmlicher Medien unterscheidet oder mit diesem überschneidet,
- die Differenzierung ihrer Einstellungen zu aktuellen politischen Krisen (z. B. Russlands Angriff auf die Ukraine)
- und die Bestimmung, inwieweit die Nutzung alternativer Medien mit themenspezifischen Formen des politischen Engagements zusammenhängt.