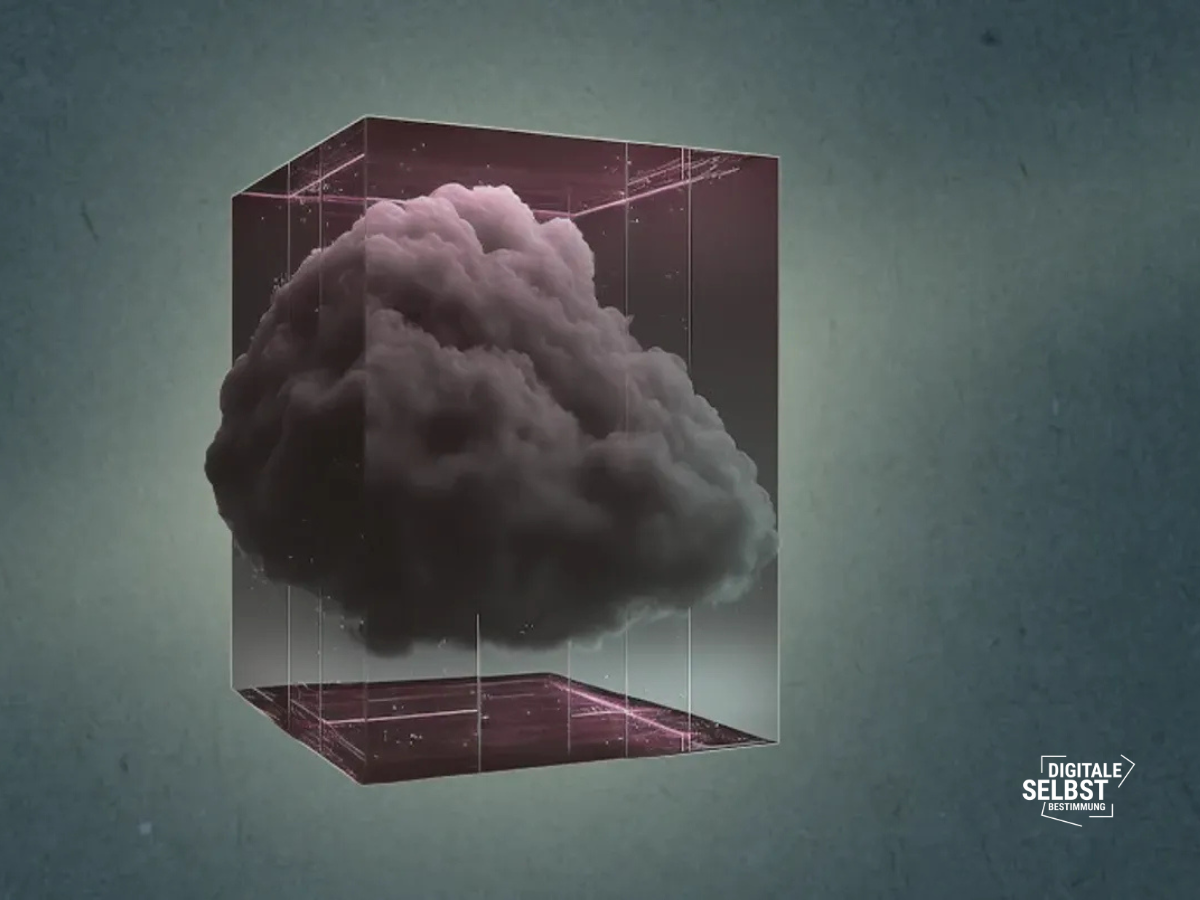
„Die Abhängigkeiten werden plötzlich schmerzhaft“
19.11.2025Im November traf sich die EU zum Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität in Berlin. Weizenbaum Forscherin Esther Görnemann bricht im Interview diesen großen Begriff runter auf konkrete Maßnahmen und Akteure.
Ob Datenschutz, Plattformmacht oder unabhängige Cloudinfrastrukturen – digitale Souveränität ist eine der zentralen Fragen moderner Demokratien geworden. Diese Woche haben Deutschland und Frankreich zum Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität eingeladen. Doch was bedeutet sie konkret, und wie lässt sie sich sichern? Das Dossier „Digitale Souveränität“ aus der Reihe fundamentals des Weizenbaum-Instituts bietet Orientierung und zeigt, wie sich Gestaltungsspielräume im digitalen Raum auf individueller, gesellschaftlicher und staatlicher Ebene stärken lassen. Wir sprachen mit der Autorin des Dossiers, Esther Görnemann, welche konkreten Maßnahmen es braucht und wer die wichtigsten Akteure sind.
Warum wird digitale Souveränität gerade jetzt so heiß diskutiert? Die Tech-Konzerne dominieren doch schon lange unseren digitalen Alltag.
Digitale Souveränität wird zum Thema, wenn die Abhängigkeiten und ein Mangel an Gestaltungsspielräumen im digitalen Raum plötzlich schmerzhaft spürbar werden. Diese Abhängigkeiten sind zwar schon präsent, der Unterschied ist, dass sie jetzt gezielt politisch instrumentalisiert werden.
Europa befindet sich in einer volatilen geopolitischen Lage, und auf politischer Ebene erkennt man mittlerweile die wichtige Rolle digitaler Technologien in diesen Dynamiken. Damit erklärt sich auch der Gipfel diese Woche. „Technologische Unabhängigkeit“ wird deshalb nun an breiter Front gefordert. Gemeint ist damit in erster Linie, dass wir entlang des gesamten Technologie-Stacks – also von Hardware über Infrastrukturen und Anwendungen bis hin zu Datenflüssen – Gestaltungsspielräume vergrößern und selbstbestimmte Alternativen entwickeln.
Wer oder was konkret steht unter der Kontrolle dieser großen Tech-Firmen?
Es geht einerseits darum, was Tech-Konzerne über uns wissen, und andererseits um die Infrastrukturen und die Ressourcen, die sie kontrollieren.
Meta zum Beispiel erfasst erstmal sämtliche Aktivitäten, die wir im Ökosystem dieser Plattform unternehmen: Fotos, Nachrichten, Kommentare und Likes, Einkäufe und natürlich unser Kontaktnetzwerk. Aber sie können auch sehr nuanciert beobachten, wie wir uns dort verhalten. Das sind wertvolle Erkenntnisse, um zu entscheiden, welche Werbung man in welchem Moment präsentieren sollte. Genau von dieser Art Vermittlungsdienst leben die Plattformkonzerne – und ohne diese Menge an Daten wären die KI-Systeme, von denen heute alle sprechen, nicht möglich.
Darüber hinaus übernehmen Plattformen mit ihren Angeboten zentrale gesellschaftliche Funktionen: Sie bieten Raum für öffentliche Diskurse, schaffen Marktplätze und verknüpfen zahlreiche Dienste, die auch zum Beispiel für die Zivilgesellschaft oder journalistische Medien unverzichtbar geworden sind. Aus dieser Hoheit über Information und Deutung erwächst eine gefährliche Manipulationsmacht, denn die Konzerne beeinflussen damit maßgeblich, was Menschen sehen, denken, und wissen. Nun werden die einstmals rein kommerziellen Interessen der Plattformen zunehmend politisch. Das beobachten wir auch in den USA, wo sie genutzt werden, um Einfluss auf unseren öffentlichen Diskurs und unsere politische Landschaft auszuüben. Das reicht von Musk, der eine „Anti-Woke-KI“ schaffen will, bis hin zum Meta-Konzern, der mit seinen Moderationsentscheidungen gezielt die Sichtbarkeit von bestimmten Inhalten verstärken oder hemmen kann.
Eine weitere wesentliche Infrastruktur sind Cloud-Server und Rechenzentren – auf deren Speicherplatz und Rechenkapazität viele digitalen Dienste und Webseiten basieren. Und viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen hierzulande arbeiten mit Clouds von amerikanischen Konzernen – Amazon Web Services ist da mit Abstand der größte Player. Nun besagt aber der US-CLOUD Act, dass amerikanische Unternehmen auf Anfrage sämtliche ihrer Daten mit US-Behörden teilen müssen. Und das auch, wenn diese auf Servern in Europa liegen. Es können also sehr sensible Daten – auch aus unserer Verwaltung – abfließen, zusätzlich zu dem Risiko, dass wir uns politisch erpressbar machen.
Letztlich geht es natürlich auch um Zugang zu Rohstoffen. Diesen Sommer hat Chinas Präsident Xi Jinping beschlossen, als Reaktion auf US-Strafzölle, den Export seltener Erden unter strenge Auflagen zu stellen. Seine Maßnahmen, wenn auch mittlerweile wieder etwas gelockert, dürften weltweit nicht nur Rüstungsindustrien empfindlich treffen, sondern auch den Technologiesektor, in dem die Metalle unter anderem für Halbleitertechnologien eingesetzt werden.
Welche Gestaltungsspielräume haben wir da als Nutzer:innen? Brauchen wir mehr Kompetenzen, um digital selbstbestimmt zu sein?
Wir haben natürlich die Möglichkeit, diese Plattformen nicht zu nutzen, oder zumindest nicht alle Funktionen – vielleicht kann man auf den KI-Assistenten auch getrost verzichten. Und es gibt auch gute Alternativen – zum Beispiel Signal statt WhatsApp oder das Fediverse statt X. Die Datenschutzeinstellungen und App-Berechtigungen auf dem Smartphone sollten wir regelmäßig überprüfen, damit sie bei einem Update nicht wieder zurückgesetzt werden. Tools und alte Profile, die wir nicht mehr benutzen, können wir löschen, ebenso wie Cookies im Browser.
Die Frage nach der Kompetenz ist eine ganz wichtige. Techniknutzungskompetenz zum Beispiel, heißt erstmal, diverse IT-Komponenten überhaupt handhaben zu können. Sie bedeutet aber auch, genug Vorwissen zu haben, um über die Herausgabe und Verarbeitung eigener Daten umfassend und qualifiziert entscheiden zu können. Es gibt aber auch noch weitere, wie Mediennutzungskompetenz, IT-Sicherheit, Rechtssicherheit und Folgenabschätzung.
All diese Kompetenzen sind eine Voraussetzung dafür, sicher und selbstbestimmt im digitalen Raum handeln zu können. Aber sie sind auch die Basis dafür, dass man sich als Bürger:in in den digitalpolitischen Dialog einbringen und Technologie selbst aktiv mitgestalten kann. Das geht auch über die individuelle Perspektive hinaus: Die Kinder, die wir heute digital befähigen, sind unsere Fachkräfte der Zukunft. Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist wiederum eine Grundvoraussetzung für digitale Souveränität.
Welche Strukturen braucht eine digital souveräne Gesellschaft? Schließlich haben Individuen oder auch Organisationen nicht auf alles einen Einfluss.
Genauso wie Einzelpersonen haben Unternehmen und die Verwaltung auch eine Auswahl, z.B. hinsichtlich der Cloud-Provider. Damit können wir eine Grundlage für eine souveräne Zukunft schaffen. Wenn wir uns aber wieder dafür entscheiden, auf US-Hyperscaler zu setzen, dann perpetuiert das unsere Abhängigkeit auf Jahre hinaus und wir fördern damit auch nicht die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und die Entwicklung technologischer Alternativen.
Open Source Software hingegen bietet all das: Wir können hier kollektiv Lösungen entwickeln, sie weiterbearbeiten, teilen und voneinander lernen. Open Source Software schafft Raum für Kooperation und Innovation. Ich bin ein großer Fan vom Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS), weil hier genau das gemacht wird: Auf allen Ebenen der Verwaltung werden gerade quelloffene, interoperable Softwareprodukte entwickelt. Und die werden beim ZenDis dann zentral für alle Verwaltungseinheiten verfügbar gemacht. Anstatt sich jahrelang an Tech Konzerne zu binden, deren Software wir nicht einsehen oder verändern können, setzen wir darauf, Technologien gemeinsam weiterzuentwickeln und miteinander zu teilen. Solche Initiativen gilt es voranzutreiben.
Wo wir keine Alternativen haben, sollten wir zumindest dafür sorgen, dass die Anbieter sich an hierzulande geltendes Recht halten. Unsere Digitalgesetze sollen ja genau das bewirken: Datenschutz, Cybersicherheit, Schutz vor Desinformation oder Schutz vor unfairen Marktpraktiken. Wir haben da sehr gute Gesetze, die auch im Interesse der Zivilgesellschaft und europäischer Unternehmen sind. Wir müssen sie aber auch umsetzen und effektiv durchsetzen. Sie dürfen nicht durch Handelskonflikte mit den USA zur Verhandlungsmasse werden und sie sollten auch nicht durch Maßnahmen der Entbürokratisierung und Staatsmodernisierung ausgehöhlt werden.
Warum tut sich Europa so schwer, den großen amerikanischen Konzernen etwas entgegenzusetzen?
Die Abhängigkeiten sind über lange Zeit gewachsen und es gibt für viele Dienste entweder noch keine bessere Alternative, oder diese Alternativen sind nicht so bekannt. Es ist weder möglich noch sinnvoll, sich auf einen Schlag von allem zu verabschieden, an das wir uns gewöhnt haben.
Aber wir haben das Recht, die umfassende Beobachtung, der wir ausgesetzt sind, einzuschränken. Es macht mir unendlich viel Freude, immer wieder die Telefone meiner Familie zu prüfen und den Apps den Zugriff auf bestimmte Daten zu verbieten. Warum will meine Taschenlampe wissen, wo ich mich gerade befinde? Da fühlt man sich gleich etwas selbstwirksamer. Ebenso bei der Verwaltung: Das Land Schleswig-Holstein stellt seine Systeme jetzt gerade umfassend auf Open-Source-Lösungen um. Es tut sich also sehr viel.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft auf dem Weg zu digitaler Souveränität?
Die Wissenschaft hat die Aufgabe, objektiv zu informieren und Orientierungswissen bereitzustellen. Und zwar nicht nur in Form von Forschungspapieren, die dann wieder nur von der wissenschaftlichen Community gelesen werden, sondern auch in anderen Formaten: in Paneldiskussionen, Medienbeiträgen und Infobroschüren, sowie im Dialog mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Stakeholdern.
Dabei ist es das allerwichtigste, dass wir als Forschende unabhängig bleiben und uns nicht zu Interessensvertretern machen lassen.
Inwiefern kann Digitale Resilienz oder Selbstbestimmung zu einem gesellschaftlichen Wert werden – oder ist sie es bereits?
Ich würde sagen, das ist sie bereits, wenn vielleicht auch nicht so explizit. Die Schmerzpunkte, die uns in Sachen digitaler Souveränität begegnen, tangieren ganz elementare Grundwerte unserer Gesellschaft: politische Unabhängigkeit, Privatsphäre, , und die demokratische innere Ordnung.
Ich glaube, dass die Menschen schon begriffen haben, wie wichtig digitale Souveränität ist, aber dass wir uns häufig in einer Art Ohnmachtsnarrativ befinden. Die Machtasymmetrien sind so groß, dass es schwer ist, sich das anders vorzustellen.
Aber wir können jetzt die entscheidenden Weichen stellen, um im digitalen Raum auf allen Ebenen mehr Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume zu schaffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Cloud-Infrastrukturen oder KI-Modelle ausrollen – und das gilt ja für Unternehmen genauso – können wir darauf achten, dass wir Technologien einsetzen, die unseren Wertvorstellungen entsprechen: Die uns nicht überwachen, uns nicht politisch manipulieren oder als Faustpfand eingesetzt werden können.
Vielen Dank für das Gespräch!
Esther Görnemann ist Referentin für Forschungssynthesen am Weizenbaum-Institut. Kern ihrer Arbeit ist es, den Forschungsstand zu zentralen Fragestellungen der digital vernetzten Gesellschaft aufzuarbeiten, um zukünftige Forschung zu informieren und den Wissenstransfer in Richtung Politik und Öffentlichkeit zu unterstützen. In ihrer Forschung beschäftigt sich Esther mit Fragen digitaler und technologischer Souveränität und den Implikationen generativer KI auf Arbeit und Beschäftigung in verschiedenen Berufsfeldern. In wissenschaftlichen Literaturüberblicken und Transferformaten für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verknüpft sie diese Themenbereiche und fasst interdisziplinäre Forschungsdiskurse zusammen.
Das Interview führte Leonie Dorn
Zum Dossier Digitale Souveränität
Was ist digitale Selbstbestimmung – und für wen? Wer fördert sie und was steht ihr im Weg? In unserer neuen Themenreihe geben Wissenschaftler:innen in Interviews, Berichten und Dossiers Einblicke in die Forschung zu Gestaltungsmacht, Autonomie und Anhängigkeiten in der digitalen Welt. Mehr erfahren